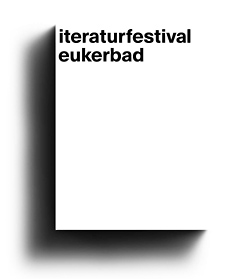30. Internationales Literaturfestival Leukerbad
Perspektiven
Längst geht es am Literaturfestival Leukerbad nicht mehr nur um die Vorstellung von Büchern. In den exklusiv zusammengesetzten Gesprächen der «Perspektiven»-Reihe werden jedes Jahr aktuelle Themen aus Gesellschaft, Politik und Literatur aufgegriffen und fortgeführt.
30. Internationales Literaturfestival Leukerbad: